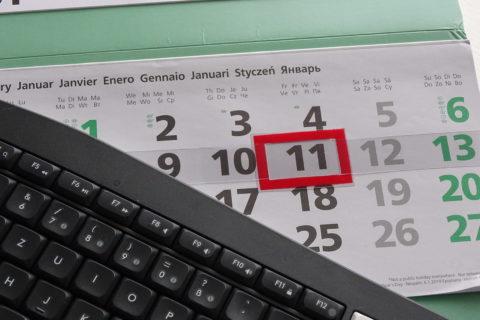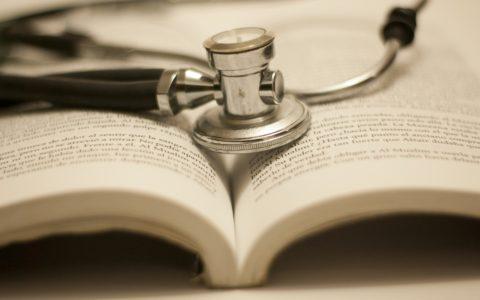Unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen für die Unterbringung eines Betreuten zur Durchführung einer Heilbehandlung gemäß § 1831 Abs. 1 Nr. 2 BGB ist eine Unterbringung nach dieser Vorschrift von vornherein nur dann genehmigungsfähig, wenn eine erfolgversprechende Heilbehandlung auch durchgeführt werden kann.

Dies setzt entweder einen die Heilbehandlung deckenden entsprechenden natürlichen Willen des Betreuten oder die rechtlich zulässige Überwindung seines entgegenstehenden natürlichen Willens mittels ärztlicher Zwangsbehandlung voraus.
Die Genehmigung einer Unterbringung zur Heilbehandlung nach § 1831 Abs. 1 Nr. 2 BGB ist daher möglich, wenn zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass sich der Betreute in der Unterbringung behandeln lassen wird, sein natürlicher Wille also nicht bereits der medizinisch notwendigen Behandlung entgegensteht, er aber (lediglich) die Notwendigkeit der Unterbringung nicht einsieht.
Ist dagegen auszuschließen, dass der Betreute eine Behandlung ohne Zwang vornehmen lassen wird, ist die Genehmigung der Unterbringung zur Durchführung der Heilbehandlung nur zulässig, wenn die Voraussetzungen für die Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme nach § 1832 Abs. 1 Satz 1 BGB vorliegen und diese gemäß § 1832 Abs. 2 BGB rechtswirksam genehmigt wird[1].
Gemessen daran konnte in dem hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall die geschlossene Unterbringung der Betroffenen nicht auf § 1831 Abs. 1 Nr. 2 BGB gestützt werden:
Vorliegend ist die Betroffene freiwillig lediglich zur Einnahme des Medikaments Zyprexa mit dem Wirkstoff Olanzapin bereit, während sie die Einnahme des für die Langzeittherapie vorgesehenen Medikaments Leponex mit dem Wirkstoff Clozapin verweigert. Eine Zwangsbehandlung mit Leponex scheidet nach den getroffenen Feststellungen wegen der ausschließlich oralen Verabreichungsform aus.
Tragfähige Anhaltspunkte für die Erwartung, dass eine Behandlung der Betroffenen mit Leponex künftig ohne Zwang vorgenommen werden könnte, bestehen nicht. Selbst wenn zu Beginn der Unterbringung noch eine gewisse Aussicht darauf bestanden haben mag, den Zustand der Betroffenen durch die Gabe von Zyprexa zumindest insoweit zu stabilisieren, dass sie die erforderliche Compliance für eine Langzeittherapie – auch mit einem anderen Medikamentenwirkstoff – entwickelt, bestand diese Erwartung im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung offensichtlich nicht mehr. Die von der Betroffenen ohnehin nur in geringer Dosierung tolerierte Einnahme von Zyprexa hat nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts trotz der inzwischen verstrichenen Unterbringungszeit keine Wirkung gezeigt, so dass es im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung an einem erfolgversprechenden Behandlungskonzept für die Betroffene fehlte, welches die Grundlage für ihre Unterbringung nach § 1831 Abs. 1 Nr. 2 BGB darstellen könnte.
Die bisher getroffenen Feststellungen tragen auch die Genehmigung einer Unterbringung der Betroffenen zur Gefahrenabwehr (§ 1831 Abs. 1 Nr. 1 BGB) nicht:
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt die Genehmigung einer geschlossenen Unterbringung nach § 1831 Abs. 1 Nr. 1 BGB zwar keine akute, unmittelbar bevorstehende Gefahr für den Betreuten voraus. Notwendig ist allerdings eine ernstliche und konkrete Gefahr für Leib und Leben des Betreuten. Dies setzt kein zielgerichtetes Verhalten des Betreuten voraus, so dass beispielsweise auch eine völlige Verwahrlosung ausreichen kann, wenn damit eine Gesundheitsgefahr durch körperliche Verelendung und Unterversorgung verbunden ist. Erforderlich sind aber objektivierbare und konkrete Anhaltspunkte für den Eintritt eines erheblichen Gesundheitsschadens. Der Grad der Gefahr ist dabei in Relation zum möglichen Schaden ohne Vornahme der freiheitsentziehenden Maßnahme zu bemessen[2].
Bislang sind keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte für die Annahme aufgezeigt, dass sich die Betroffene erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügen werde, wenn ihre geschlossene Unterbringung unterbleibt. Allein die in der Beschwerdeentscheidung vereinzelt enthaltenen Hinweise darauf, dass die Betroffene durch ihr Wahnerleben so stark beeinträchtigt sei, dass „sie sich nicht mehr ausreichend selbst versorgen“, „keinerlei Gefahren abschätzen … und Dritte bedrohen“ könne, genügen dafür nicht. Erforderlich sind vielmehr nähere Feststellungen zur konkreten Art der befürchteten selbstschädigenden Handlungen und der durch sie möglicherweise eintretenden erheblichen Gesundheitsschäden.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 17. Januar 2024 – XII ZB 434/23